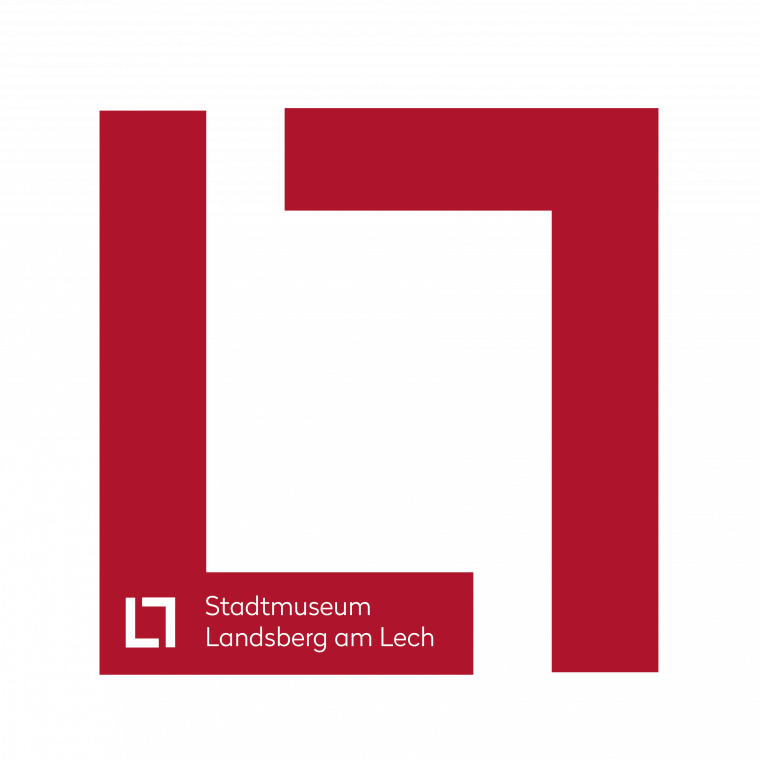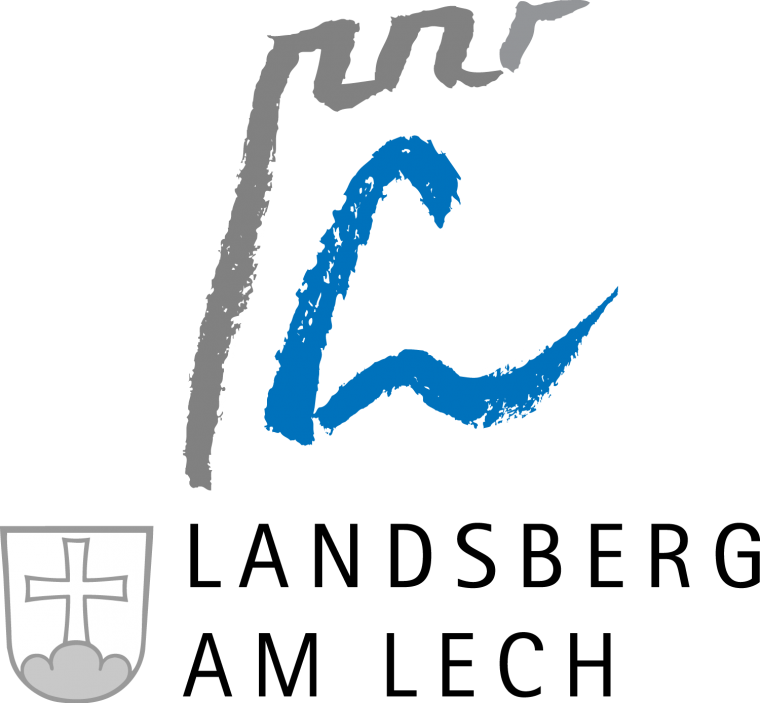Die Landsberger Zeitgeschichte im Stadtmuseum
Vorstellung des Planungsstands im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss
17.03.2022
Von Sonia Fischer
Am 9. März 2022 stellte Museumsleiterin Sonia Fischer im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss den derzeitigen Planungsstand zum Konzept der neuen Dauerausstellung mit dem Titel „Wege nach Landsberg“ im Stadtmuseum vor. Dabei legte sie den Schwerpunkt auf die Planungen zum Thema Zeitgeschichte, das im künftigen Museum ein ganzes Stockwerk einnehmen wird. Im Oktober soll das Konzept in einer Podiumsdiskussion mit dem wissenschaftlichen Beirat öffentlich vorgestellt werden.
Das Museum als offener Lernort
Im ersten und zweiten Stock finden zukünftig die Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zur Zeitgeschichte Platz. Im dritten Stock wird neben Büros und museumspädagogischem Raum Fläche für Sonderausstellungen eingerichtet. Das Erdgeschoss erhält einen Veranstaltungsraum für Eröffnungen, Lesungen oder Konzerte sowie ein „Museumsforum“ als öffentlich zugänglichen Aufenthaltsbereich mit Zugang zum Garten. Hier soll ein offener Ort entstehen für Workshops, neue Formate, aber auch, um sich zu treffen oder ein ruhiges Plätzchen zum Lesen oder Arbeiten zu finden.
Die Herausforderung bei der Entwicklung eines Museumskonzeptes liegt darin, nicht nur Themen aus der Masse an Möglichkeiten herauszufiltern und zu einem sinnigen, logischen und attraktiven Gesamtbild zu formen, sondern auch mit einem didaktischen Konzept die unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen einzubinden. Das Stadtmuseum als Lern- und Bildungsort fokussiert sich auf die drei Hauptzielgruppen der Schulklassen, der Touristen und der Familien. Während wir also zum Beispiel Lernboxen für Schulklassen entwickeln werden, um selbsttätiges Lernen in Kleingruppen zu ermöglichen, benötigen Touristen mehrsprachige Angebote und fokussierte Vermittlung der Highlights. Für Familien dagegen sind ein spielerischer Zugang und das Mehr-Sinne-Prinzip besonders wichtig.
 Bewerbungsentwurf zur Abteilung Zeitgeschichte aus dem Gestalterbüro facts and fiction. © facts and fiction
Bewerbungsentwurf zur Abteilung Zeitgeschichte aus dem Gestalterbüro facts and fiction. © facts and fiction
Ein Stockwerk zum 20. Jahrhundert
Stadtmuseen erzählen alle an ihrem jeweiligen Ort, was sie dort am besten erzählen können. Mit Blick auf die Landsberger Stadtgeschichte lässt sich eine Verdichtung zeitgeschichtlicher Ereignisse im 20. Jahrhundert konstatieren, die zu allererst die Themensetzung und ihre bildungspolitische Vermittlung in unserer Einrichtung begründet. Den meisten ist bekannt, dass Adolf Hitler in "Festungshaft" in Landsberg am Lech den ersten Teil seiner Hetzschrift „Mein Kampf“ schrieb. In Landsbergs Umgebung befand sich der größte Außenlagerkomplex des KZ-Dachau. In Nachkriegszeit saßen die verurteilten NS-Kriegsverbrecher im War Criminal Prison, während wenig entfernt im Displaced-Persons-Camp Überlebende des Holocaust auf ihre Ausreise warteten.
Die Ausstellung verzahnt die deutsche Geschichte mit der lokalen Perspektive. Die Räume bilden einen Weg durch die Zeit von „Landsbergs Weg in den Nationalsozialismus“ weiter in die NS-Zeit unter dem Titel „Volksgemeinschaft ist Ausgrenzung“ über die Nachkriegszeit "Zwei Wege nach Landsberg" bis in die Gegenwart, in der wir die Frage stellen, wie wir uns an die NS-Zeit erinnern.
Hitlers "Festungshaft" in den Jahren 1923/24 eröffnet den Blick auf seine Ideologie, die er mit seiner Hetzschrift "Mein Kampf" in Landsberger Haft beschrieb, und auf das Interesse der Lokalpolitik, die ehemlige Haftzelle touristisch zu vermarkten und Landsberg einen Platz im Führerkult zu sichern. Ein eigener Raum zur Zeit des Nationalsozialismus geht auf das Konzept der „Volksgemeinschaft“ ein, die der Bevölkerung soziale Versprechen machte, andererseits aber politische Gegner, kranke und unangepasst lebende Menschen und andere Personen radikal ausschloss, allen voran Jüdinnen und Juden. Die Ausstellung geht mit biographischen Beispielen darauf ein, wie die Ausschlussmechanismen in einem zweigesichtigen System der geschönten Wirklichkeit und der exzessiven Gewalt konkret vor Ort funktionierte. Die Zuspitzung dieser fatalen Politik wird im Ausstellungbereich zum KZ-Außenlagerkomplex Landsberg-Kaufering deutlich.
Es ist aus heutiger Sicht völlig unerklärlich, dass nur wenige Jahre nach Kriegsende am 7. Januar 1951 dreitausend bis viertausend Menschen auf dem Landsberger Hauptplatz für die NS-Kriegsverbrecher demonstrieren gingen, obwohl die Anwesenheit von tausenden Opfern der Terrorherrschaft im DP-Lager der Bevölkerung präsent vor Augen stand. Warum die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit so gering war, bietet Anlass zur Diskussion, über das eigene moralische Wertesystem ins Gespräch zu kommen.
Uns alle beschäftigt die Frage, welche Ereignisse, Verhaltensweisen und Werte damals in die Katastrophe geführt haben. Deshalb ist auch heute noch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus von so großem öffentlichem Interesse. Die Ausstellung stellt Wissen über den Nationalsozialismus bereit und öffnet Bezugsräume zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Ausstellung soll kein Geschichtsbuch aufschlagen, in dem abgeschlossene Vergangenheit nachzulesen ist. Sie soll zum Nachdenken anregen, Impulse setzen und demokratische Werte stärken.
Die Neugestaltung der Dauerausstellung und der Nutzflächen kostet rund 2,6 Millionen Euro. Auf Basis des vorgestellten Konzepts und der Kostenschätzung der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern konnten Fördermittel in Höhe von 2,2 Millionen Euro bereits eingeworben werden. Darunter die Fördermittel des Bundesministeriums für Kultur und Medien im Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ in Höhe von 1,5 Millionen Euro.